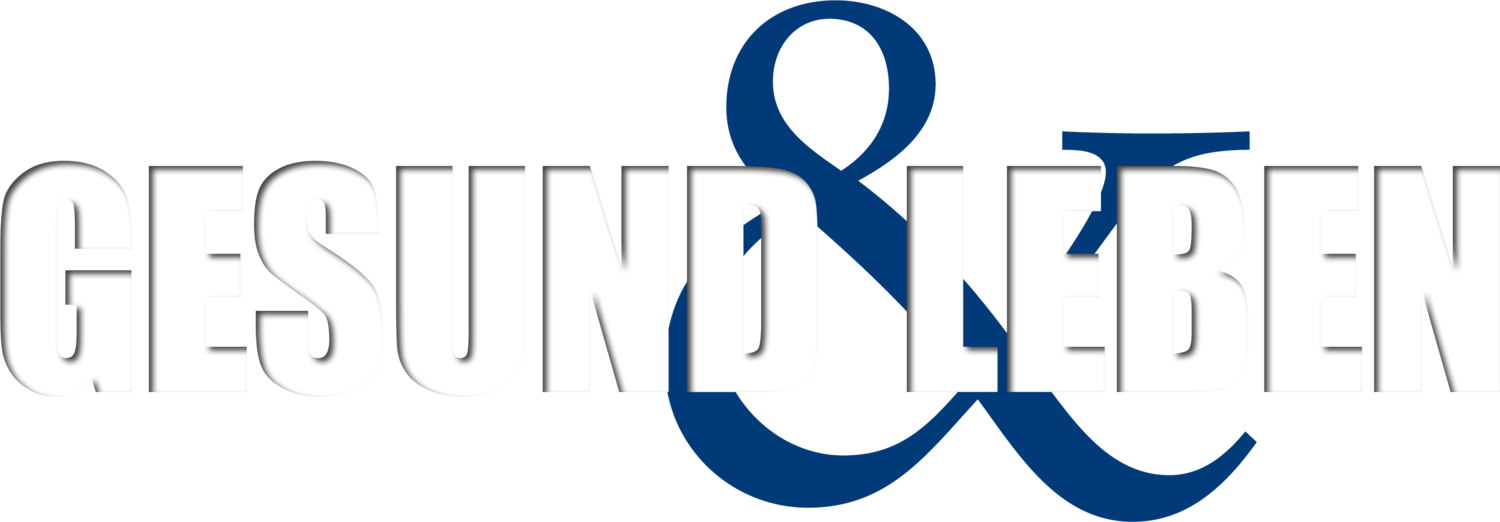Starke Blase
Unkontrollierbarer Harnverlust und Blasenentzündungen können den Alltag massiv belasten. Wie sich Beschwerden zeigen und was hilft.
Der Harnleiter sowie die Harnröhre sind für die Speicherung und den Transport des Urins zuständig.
Häufig vergessen wir, welchen guten Dienst sie täglich verrichtet: unsere Blase. Erst wenn sie Probleme macht, Schmerzen beim Urinieren auftreten oder es immer wieder zu einem unwillkürlichen Harnverlust kommt, tritt ihre wichtige Funktion in den Vordergrund. Vor allem Frauen im höheren Alter sind von Harninkontinenz betroffen, die umgangssprachlich als Blasenschwäche bezeichnet wird. Blasenschwäche oder Inkontinenz sind allerdings immer noch sehr schambehaftet und zählen zu den gesellschaftlichen Tabuthemen, über die ungern gesprochen wird. Die Betroffenen erleben den Kontrollverlust über die Blase als außerordentlich belastend. Besonders die sogenannte Dranginkontinenz erschwert normale Alltagsverrichtungen. Dabei tritt plötzlich ein starker Harndrang auf und es kann zu einem unkontrollierbaren Wasserlassen kommen, noch bevor die Toilette erreicht wird. Für die Entstehung einer Dranginkontinenz kommen vielfältige Ursachen wie Zuckerkrankheit, chronische Blasenentzündungen, neurologische Erkrankungen, Übergewicht oder der in Wechseljahren einsetzende Östrogenmangel infrage.
WEITERLESEN im ePaper!
Blasentagebuch ist ein wichtiges Tool
Urologin Dr. Anne-Catherine Piskernik
Wie wird Inkontinenz behandelt?
Bei der Drang-, der Belastungsinkontinenz und der Mischform, bei der es zu einem unkontrollierbaren Harnverlust bei körperlicher Anstrengung sowie einem plötzlichen Harndrang kommt, ist die Physiotherapie für den Beckenboden die erste Wahl. Ist die Patientin in der Postmenopause, kann die lokale Behandlung mit einer östrogenhaltigen Creme eine Verbesserung erzielen. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit ist die Elektrostimulation mit einem Inkontinenz-Therapiegerät, das mittels elektrischer Impulse die Verschlussfunktion der Blase stärken kann. Die Einschulung erfolgt über die Fachärztin, den Facharzt oder eine Physiotherapeutin bzw. einen Physiotherapeuten. Die Behandlung sollte regelmäßig zuhause über mehrere Monate hinweg durchgeführt werden.
Was ist noch hilfreich?
Ein wesentliches Tool ist das Führen eines Blasentagebuchs über einen Zeitraum von 48 Stunden. Darin werden die Zeitpunkte der Flüssigkeitsaufnahme, die Trink- und Harnmengen sowie das Verspüren eines Harndrangs und der Urinverlust schriftlich festgehalten. Mithilfe des Protokolls sieht man die Gewohnheiten der Patienten und man erhält ein genaues Bild der Trink- und Harnmengen bei Tag und bei Nacht.
Es gibt Aufschluss, ob der Harndrang der Patientin so stark ist, dass sie schon wegen 30 ml auf die Toilette muss, oder ob sie eine hohe Trinkmenge von vier Litern hat, wo sie einfach naturbedingt auf die Toilette muss. Manchmal lassen sich schon durch Änderungen der Trinkgewohnheiten Verbesserungen erzielen.
WEITERE INFOS im ePaper!
Text Jacqueline Kachelt⎪Foto: © istock Mintra Kwthijak,