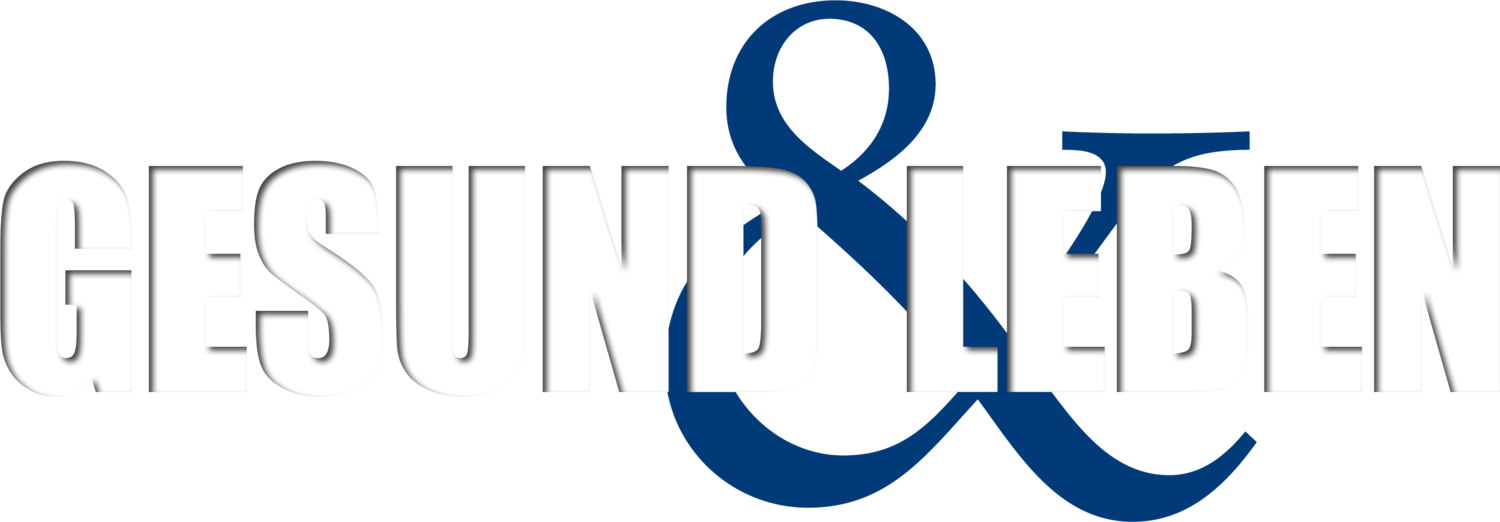Stabile Psyche
Psychische Erkrankungen zählen zu den größten Bedrohungen für das menschliche Wohlbefinden.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) tragen die Europäerinnen und Europäer eine große seelische Last. Rund ein Viertel erlebt im Laufe eines Jahres Depressionen oder Angstzustände. Die WHO schätzt die durch psychische Störungen verursachten Kosten in der EU auf 170 Milliarden Euro jährlich. Den engen Zusammenhang zwischen Körper und Seele untermauern wissenschaftliche Ergebnisse. Studien belegen, dass psychische Erkrankungen (wie Depressionen, Verhaltens- und Zwangsstörungen, Psychosen, bipolare Störungen, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit u. a.) die Lebenserwartung stärker als alle anderen Krankheiten senken. Laut WHO sterben Menschen mit psychischen Störungen zwanzig Jahre früher als die allgemeine Bevölkerung. Psychische Erkrankungen treten nämlich häufig im Vorfeld oder infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs auf. So haben Menschen, die an Depressionen leiden, ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Eine Rolle spielen auch ein erhöhtes Suizidrisiko, ein nachlässiger Umgang mit der eigenen Gesundheit oder die Nebenwirkungen von Medikamenten.
Interview - Gravierender Mangel an pschiatrischer Versorgung
Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata,
Leiter der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien
Sind bestimmte Gruppen stärker von psychischen Erkrankungen betroffen?
Wir wissen aus Österreich, aber auch von internationalen Daten, dass Frauen öfter unter Depressionen und Angststörungen leiden, während Männer häufiger von Alkohol- oder Drogenabhängigkeit betroffen sind. Bei schizophrenen Psychosen gibt es keinen Unterschied in der Häufigkeit, der Krankheitsbeginn liegt bei Männern aber etwas früher als bei Frauen. Die Ursachen dafür sind komplex und nur teilweise bekannt. Schizophrene Psychosen treten in der Stadt etwas häufiger als in ländlichen Regionen auf. Es gibt Hinweise darauf, dass in Städten der Stresslevel generell höher ist und dass beengte Wohnverhältnisse in städtischen Regionen wenige Möglichkeiten zum Rückzug geben. Diese Risiken können aber nur einen Teil der Unterschiede erklären.
Wie steht es um die psychische Gesundheit seit Ausbruch der Corona-Pandemie?
Die Covid-19-Pandemie hat zweifellos Auswirkungen. Berichte aus psychiatrischen Krankenhausabteilungen zeigen, dass während der Lockdown-Phasen die Patientenzahl zwar geringer als üblich war, diese Menschen jedoch besonders schwer erkrankt waren. Auch über vermehrte Fälle von Substanzmissbrauch und Alkoholintoxikationen wurde berichtet. Langfristige wirtschaftliche und soziale Folgen wie Arbeitslosigkeit oder finanzielle Probleme, deren Ausmaße noch nicht einschätzbar sind, werden vermutlich auch längerfristig Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben.
Wie beurteilen Sie die gesundheitspolitischen Maßnahmen im Bereich mentale Gesundheit?
Wir haben einen gravierenden Mangel an Psychiaterinnen und Psychiatern, welche die breiteste Ausbildung zur Behandlung psychisch Kranker haben. Aufgrund der Altersstruktur stehen wir vor einer Pensionswelle und die Möglichkeiten zur Ausbildung sind durch strukturelle Mängel begrenzt. Das ist ein Problem, das auch andere Mangelfächer haben. Darüber hinaus ist die Zahl der Kassenplätze seit Jahren zu gering: In ganz Österreich stehen nur rund 140 Stellen mit Kassenvertrag zur Verfügung. Aus diesem Grund müssen auch schwer psychisch Kranke immer wieder monatelang auf eine Behandlung warten.
Text: Jacqueline Kacetl | Foto: iStockphoto / Wundervisuals, ZVG
Mehr zum Thema „Stabile Psyche“ erfahren Sie in GESUND & LEBEN 11/21.