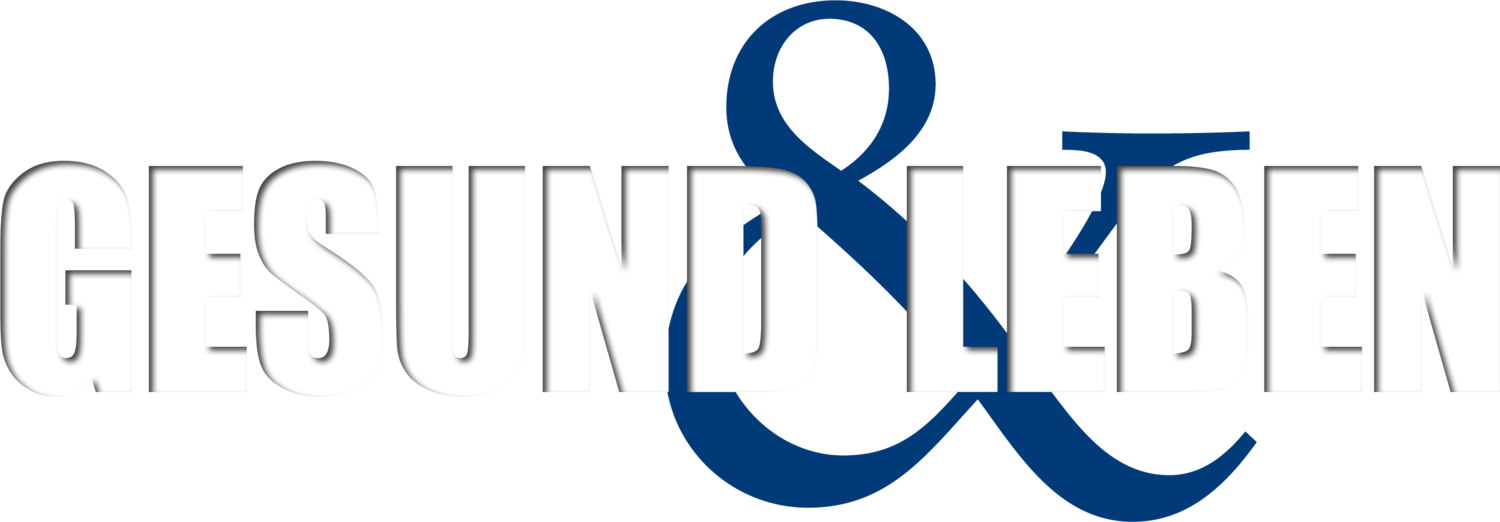Suchtfalle Genuss
Rotwein zwecks Entspannung, Schokolade als Seelenschmeichler oder das Roulette-Spiel für den Nervenkitzel – unser Alltag bietet viele Verlockungen. GESUND & LEBEN zeigt, ab wann aus Genuss Verdruss wird, wodurch ein Suchtkreislauf entsteht und wie man ihn unterbricht.
Zweifelsohne sind wir eine hedonistisch geprägte Gesellschaft, die von der Suche nach Glück und Momenten des Wohlbefindens angetrieben wird. Sei es bei der ausgedehnten Shoppingtour, dem wohlverdienten Bier nach einem harten Arbeitstag, der Zigarette „danach“ oder dem überdimensional großen Popcorn-Behälter im Kino – wir konsumieren Genussmittel und forcieren Verhaltensweisen, die uns Freude und Glückseligkeit versprechen. Doch: Wie sieht es mit der Einhaltung dieser Versprechen aus? Machen uns diese Dinge wirklich (nachhaltig) glücklich?
Prim. Priv.-Doz. Dr. Kurosch Yazdi-Zorn,
Vorstand der Klinik für Psychiatrie am Kepler Universitätsklinikum, Linz
Die „Jagd“ nach dem besten Endorphin-Cocktail, wenn man so will, birgt tatsächlich auch Gefahren. Wenn die Selbstregulation versagt, kann das Streben nach Lustbefriedigung in einem gefährlichen Kontrollverlust münden. Oft geschieht dies schleichend: Trotz des Wissens um die gesundheitlichen Risiken, die etwa mit übermäßigem Alkoholkonsum, Rauchen, Spielen, Kaufen oder Essen verbunden sind, steigern viele ihre Gewohnheiten kontinuierlich. „Jemand, der süchtig ist, könnte es vorziehen, Alkohol am Morgen zu konsumieren, anstatt nüchtern zur Arbeit zu erscheinen, oder er verspielt Geld, das für die Miete vorgesehen war“, verdeutlicht Prim. Priv.-Doz. Dr. Kurosch Yazdi-Zorn, Vorstand der Klinik für Psychiatrie am Kepler Universitätsklinikum in Linz.
In der öffentlichen Wahrnehmung wird Sucht häufig nur dort erkannt, wo gesetzliche Grenzen überschritten werden. Doch dieser enge Blickwinkel verkennt die Realität: Letztlich kann nahezu alles, das kurzfristig ein gutes Gefühl auslöst, zu einer Abhängigkeit führen. „Wir unterscheiden zwischen substanzgebundenen Süchten wie zum Beispiel nach Nikotin, Alkohol oder Drogen, und substanzungebundenen Süchten, also Verhaltenssüchten wie beispielsweise die Glücksspiel-, Kauf- und Mediensucht oder diverse Essstörungen“, weiß Yazdi-Zorn.
Psychotherapeutin Elisabeth Heller
www.elisabeth-heller.at
„Es gibt eine gewisse ,Anfälligkeit‘ bestimmter Personen für Suchtverhalten: einerseits aufgrund biologischer/genetischer Voraussetzungen, andererseits aufgrund entwicklungsgeschichtlicher Bedingungen wie Störungen in der pränatalen Entwicklung oder dem Aufwachsen bei süchtigen oder psychisch erkrankten Eltern.“
Bin ich süchtig?
Die Grenze zwischen Genuss und Sucht ist oft fließend und wird von individuellen Bedürfnissen, gesellschaftlichen Normen und persönlichen Lebensumständen beeinflusst. Der schmale Grat dazwischen macht sich schon in unserer Sprache bemerkbar. „Ohne meinen Kaffee am Morgen geht gar nichts“ oder „Ich bin süchtig nach Schokolade“ sind nur einige Redewendungen, die das deutlich machen.
Der etymologische Hintergrund des Worts „Sucht“ (germanisch „siech“ = Siechtum) weist aber im Gegensatz zur Lust auf eine Erkrankung hin. Offiziell, so sind sich Expertinnen und Experten sicher, kann die Abhängigkeitsdiagnose dann gestellt werden, wenn während des letzten Jahres drei oder mehrere der folgenden Merkmale gleichzeitig vorhanden waren (Abhängigkeitssyndrom nach ICD 10):
starker Konsumdrang
Kontrollverlust
Toleranzentwicklung
körperliche Entzugssymptome
Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Substanzkonsums
anhaltender Substanzkonsum trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen
Dopamin als Auslöser
Dr. Katharina Turecek
Gehirntrainerin, Wien
Warum der heimtückische Suchtkreislauf in Gang gesetzt wird, hängt von neurobiologischen Prozessen ab. „Hauptverantwortlich für das Entstehen einer Sucht ist unser mesolimbisches Belohnungssystem im Gehirn. Es wird durch unterschiedliche Reize wie Nahrung, Alkohol oder Sex aktiviert und führt zur Ausschüttung von Botenstoffen wie Dopamin und Endorphinen, den sogenannten Glückshormonen“, so die Wiener Gehirntrainerin Dr. Katharina Turecek. Prinzipiell sorgt das System dafür, Tätigkeiten zu wiederholen, die gut für uns sind, also zu essen, zu trinken oder uns fortzupflanzen. Kommt es hier allerdings zu einer Überreaktion, entsteht Sucht und somit ein teuflischer Kreislauf: Stoffe oder Verhaltensweisen, die uns ihre positive Wirkung bloß vorgaukeln, werden verstärkt konsumiert bzw. getätigt, um den Glückshormonspiegel aufrechtzuerhalten. „Sämtliche Süchte sind auf eine Fehlsteuerung im Dopaminsystem zurückzuführen“, bestätigt Turecek.
Pubertierende sind besonders suchtanfällig, weil wichtige Teile im Gehirn erst heranreifen.
WEITERLESEN im ePaper!
Text: Carolin Rosmann ⎪ Fotos: iStock_VectorFusionArtw_ Ridofranz_ eternalcreative, Thomas Peschat; pro mente oÖ; Tanja heissenberger münster