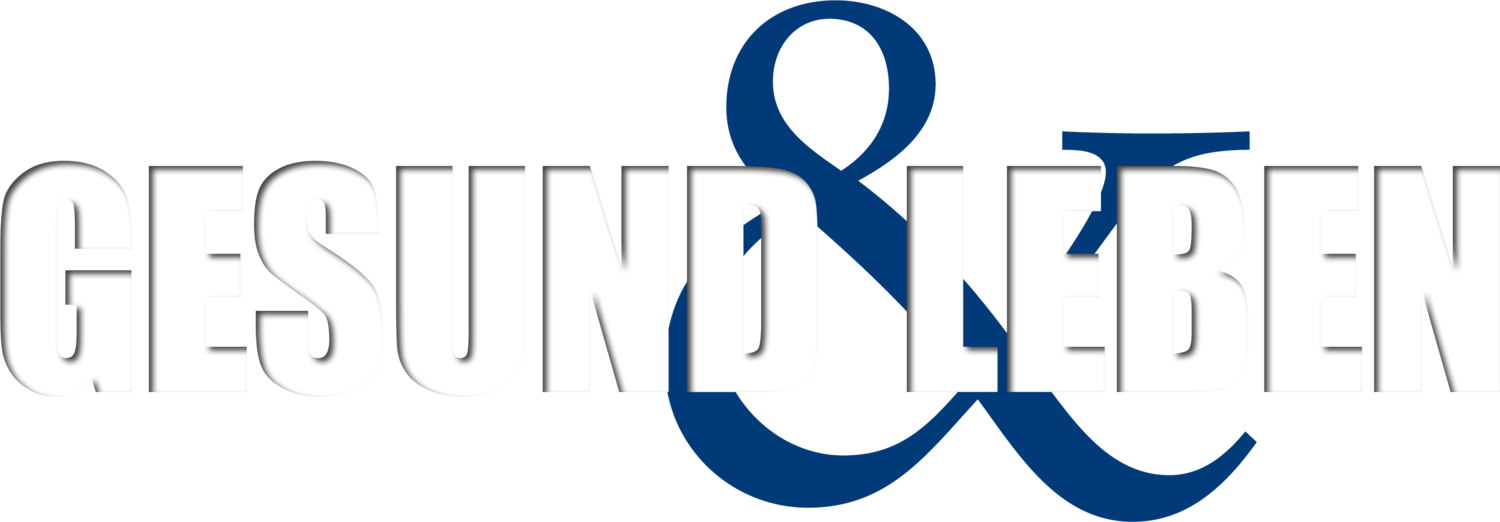Wie Künstliche Intelligenz die Gesundheit revolutioniert
Die Digitalisierung prägt unsere Lebenswelt und revolutioniert auch die Bereiche Ernährung und Gesundheit. Im Zentrum dieser Entwicklung stehen die Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data, die riesigen Datenmengen analysieren, individuelle Gesundheitsrisiken erkennen und neue Ansätze für Prävention und Therapie ermöglichen können.
Diese Transformation wird unter dem Begriff "eHealth" zusammengefasst und beschreibt den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zur Förderung der Gesundheit und gesundheitsnaher Bereiche. Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) bieten beispielsweise Unterstützung bei Zivilisationskrankheiten wie Adipositas und Diabetes. Smartwatches messen in Echtzeit Biodaten und Algorithmen helfen, personalisierte Ernährungspläne zu erstellen. Doch mit den Entwicklungen gehen auch zentrale Herausforderungen einher: Datenschutz, technische Zugänglichkeit, der Erwerb digitaler Kompetenzen und die Etablierung klarer Entscheidungsgrundlagen hinken dem schnellen technischen Fortschritt oft hinterher. „Die Potenziale von KI in Ernährung und Gesundheit sind immens. Für einen funktionierenden Kreislauf von Gesundheitsdaten benötigen wir jedoch flexible, aber sichere Regulierungen für kluge und verantwortungsvolle Anwendungen", sagt Marlies Gruber, Geschäftsführerin des forum.ernährung heute (f.eh). Wie Potenziale der KI für Gesundheit und Ernährung gehoben werden können, beleuchtet das f.eh.
Apps & Co auf Vormarsch
Die österreichische eHealth-Strategie 2024 setzt auf acht Ziele, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Dazu gehören etwa der digitale Zugang zum Gesundheitssystem und der Ausbau telegesundheitlicher Angebote. Zudem sollen relevante Gesundheitsregister etabliert und die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten gestärkt werden. Durch das Zugänglichmachen von Innovationen und den Ausbau digitaler Kompetenzen bei Fachkräften und der Bevölkerung will die Strategie die Gesundheitsversorgung effizienter und zukunftsfähig machen. In einem ersten Schritt wird der Ausbau der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) vorangetrieben. Auch digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sollen verstärkt zum Einsatz kommen, um chronisch erkrankte Personen besser zu unterstützen. So können beispielsweise Diabetes-Apps helfen, Blutzuckerwerte zu überwachen, Ernährungstipps zu geben oder Hinweise zur Insulindosierung zu liefern. Ein Pilotprojekt zur Erprobung dieser Anwendungen startet im kommenden Jahr, mit dem Ziel, DiGA langfristig in die Regelversorgung zu integrieren. Auch in der Ernährungsberatung sind die Möglichkeiten, die KI bietet, enorm: Intelligente Algorithmen können Essgewohnheiten analysieren, genetische Voraussetzungen berücksichtigen und darauf basierend personalisierte Empfehlungen geben. "Besonders bei individualisierten Ernährungsplänen und der Unterstützung eines gesunden Lebensstils sehen wir große Chancen in der KI", so Marlies Gruber. „Gleichzeitig müssen wir den ethischen Umgang mit diesen neuen Werkzeugen sicherstellen. Nur so können wir sie verantwortungsvoll nutzen und die Gesundheitsversorgung umfänglich für alle verbessern."
Chance für die Wissenschaft
Auch die Forschung profitiert enorm von KI-gestützten Analysen großer Datenmengen. Big Data ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen Ernährung, Lebensstil und Gesundheit zu entdecken, die bisher unklar waren. Die Fähigkeit, riesige Datenmengen zu analysieren, bietet neue Ansätze für personalisierte Gesundheitsstrategien und eine effektivere Prävention, gleichzeitig sind verschiedene Datenqualitäten und ethische Standards zu berücksichtigen. Um wissenschaftliche Erkenntnisse voranzutreiben, ist der Zugang zu hochwertigen, strukturierten Gesundheitsdaten deshalb entscheidend. Dafür braucht es nicht nur technologischer Innovation, sondern auch einer klaren Regulierung, die die Balance zwischen Datenschutz und Forschungszwecken wahrt. Die Digitalisierung kann die Eigenverantwortung stärken, birgt jedoch Risiken wie eine digitale Kluft oder ungleiche Zugänge. Nicht alle Fachkräfte verfügen über das nötige Wissen oder Vertrauen in KI-basierte Systeme. Studien zeigen dementsprechend, dass der digitale Kompetenzaufbau in diesem Bereich generell dringend gefördert werden muss, um das volle Potenzial der Technologie auszuschöpfen. „Wir müssen darauf achten, dass niemand zurückgelassen wird – sei es durch mangelnde digitale Kompetenz oder fehlende Infrastruktur", so Marlies Gruber.
Foto: © istock Ignatiev